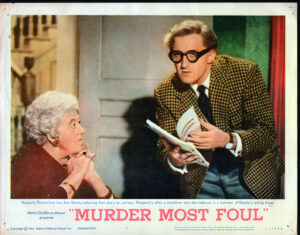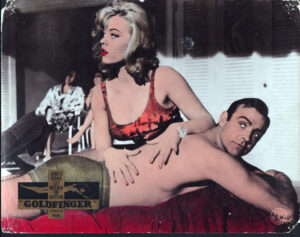Der titelgebende „Baby“ war tatsächlich ein echter Leopard. Cary Grant und Hepburn drehten viele Szenen mit ihm, allerdings wurden gefährliche Aufnahmen mit einem Stunt-Double oder Trickmontagen umgesetzt. Trotzdem war der Dreh nicht ohne Risiko.
Der Leopard „Nissa“ war handzahm, aber eben doch ein Raubtier. Cary Grant hatte großen Respekt (lies: Angst) vor ihm. In Szenen, in denen er und der Leopard nah beieinander im Bild sind, wurde oft mit geteilten Aufnahmen (Split Screen) gearbeitet. Aber einmal saß Nissa wirklich nur knapp zwei Meter hinter Grant – und brüllte aus heiterem Himmel. Der Schnitt, bei dem Grant sichtbar zusammenzuckt, ist echt.
Howard Hawks ließ die Schauspieler oft improvisieren, was zu einer enormen Spielfreude, aber auch zu Drehtagen voller Pannen führte. Grant soll den berühmten Satz „I just went gay all of a sudden!“ spontan eingebaut haben – einer der ersten humorvollen Verwendungen des Wortes „gay“ in einem Hollywoodfilm.
Eine Szene spielt im Regen, und Hawks ließ sie in einem echten Wasserfall-artigen Schauer drehen. Grants Hose lief voll, Hepburn bekam Lachanfälle, und sie mussten den Take mehrfach abbrechen. Am Ende war die Szene so voller Improvisation, dass Teile davon spontan im Film blieben.
Hepburn hatte während des Drehs oft unkontrollierbare Lachanfälle, besonders bei Szenen mit dem Leopard. Hawks musste ihr schließlich beibringen, den Mund hinter einer Hand zu verstecken oder sich abwenden, um die Takes zu retten.
Der Film war teuer in der Produktion und galt für damalige Verhältnisse als „verrückt“: ein chaotischer Plot, ein wilder Leopard, Dialoge, die kaum Luft zum Atmen lassen.
Das Publikum war verwirrt, Kritiker waren gespalten, und an den Kinokassen lief es miserabel.
Für das Studio RKO war das besonders bitter, weil Katharine Hepburn zu diesem Zeitpunkt schon als „schwierig“ galt. Nach mehreren Flops tauchte ihr Name 1938 sogar auf einer Liste der „Box Office Poison“-Stars – also Schauspieler, die angeblich keinen Erfolg mehr garantieren.
RKO war so enttäuscht, dass man den Film nach kurzer Auswertung aus vielen Kinos abzog.
Im Archiv galt er als „gescheiterte Komödie“, und es gab tatsächlich Überlegungen, ihn in Zukunft nur noch in stark gekürzter Fassung zu zeigen oder gar nicht mehr.
Erst in den späten 1940er- und 1950er-Jahren entdeckten Filmkritiker in den USA und Frankreich den Film neu.
Besonders die „Cahiers du cinéma“-Autoren (darunter spätere Regisseure wie François Truffaut) lobten Howard Hawks’ Timing und die Chemie zwischen Hepburn und Grant.
In dieser Phase wurde der Film in Programmkinos wiederaufgeführt – und plötzlich funktionierte er: Das Publikum liebte den anarchischen Humor.
Heute steht „Leoparden küsst man nicht“ auf vielen Listen der besten Komödien aller Zeiten, ist im National Film Registry der USA archiviert und gilt als einer der einflussreichsten Screwball-Filme.
Ironischerweise ist gerade das Tempo und die Absurdität, die damals so viele irritierte, heute der Grund, warum er als zeitlos gilt.
„Leoparden küsst man nicht“ inspirierte viele spätere romantische Komödien, darunter „Is’ was, Doc?“ (1972) von Peter Bogdanovich, der den Film als direkte Hommage drehte.